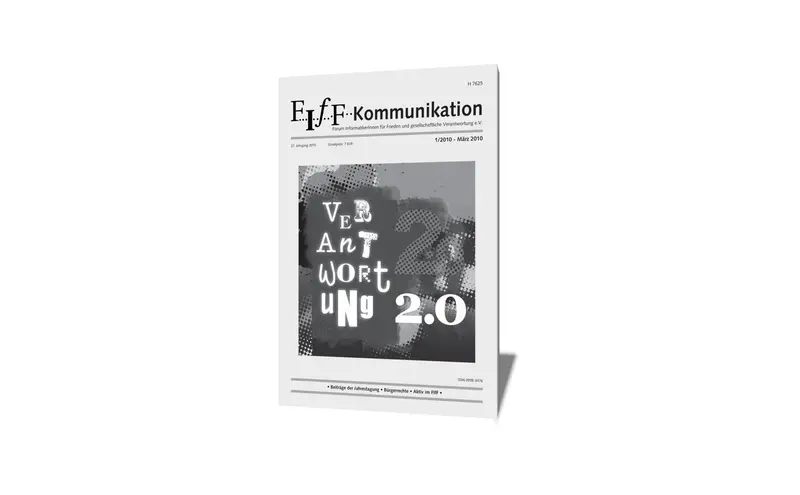FIfF Jahrestagung 2009
Verantwortung 2.0
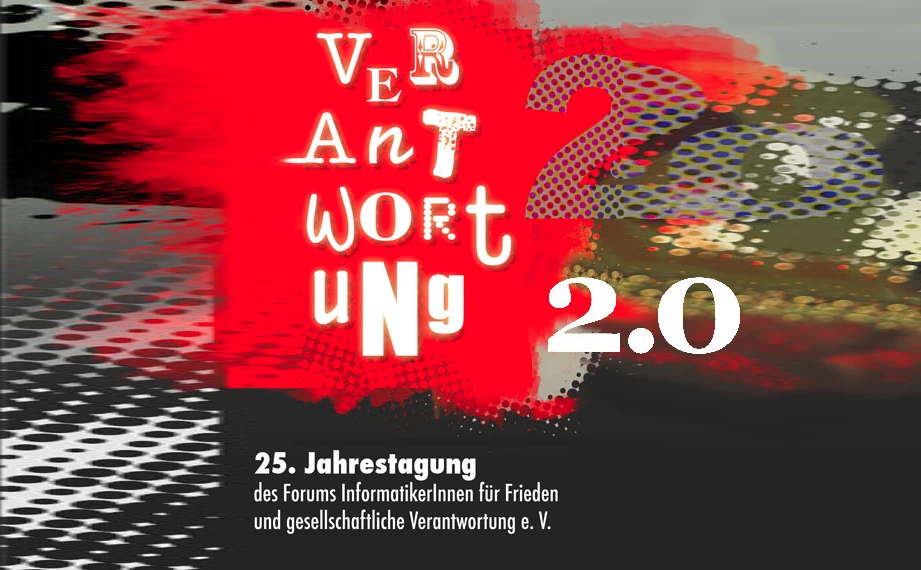
angepasstes Motiv der FIfF Jahrestagung 2009
- 13.11.2009 bis 15.11.2009
- Uni Bremen, Villa Ichon und Haus der Wissenschaft
- Bremen
Das FIfF besteht seit 25 Jahren, gegründet im denkwürdigen Orwell-Jahr 1984. Nachdem die Friedensthematik bereits im vorigen Jahr auf der Jahrestagung in Aachen ausführlich behandelt wurde, soll in diesen Jahr ein Bogen gespannt werden von der gesellschaftlichen Verantwortung im Namen des FIfF zu den neuen Herausforderungen, die Web 2.0, das Internet der Dinge, die digitale Verschmelzung aller Medien und die damit verbundenen kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen mit sich bringen. Der Zusatz 2.0, der mit leichter Ironie an entsprechende Begriffsbildungen wie Web 2.0, War 2.0, Stasi 2.0 angelehnt ist, soll andeuten, dass verantwortlicher Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnik und allen weiteren Errungenschaften und Hervorbringungen der Informatik durch die erreichte Verbreitung und Durchdringung in allen gesellschaftlichen Bereichen eine wachsende Herausforderung darstellt. Die Jahrestagung nimmt damit auch den Appell der Ethischen Leitlinien der GI von 1994 und 2004 auf, deren Artikel 11 zur soziale Verantwortung lautet: „Die GI unterstützt den Einsatz von Informatiksystemen zur Verbesserung der lokalen und globalen Lebensbedingungen. Informatikerinnen und Informatiker tragen Verantwortung für die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit; sie sollen durch ihren Einfluss auf die Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von Informatiksystemen zu ihrer sozial verträglichen Verwendung beitragen.“ Die Jahrestagung soll in diesem Sinne ein Zeichen setzen. Das Tagungsmotto lässt sich dann auch auf den ökologischen Imperativ aus Hans Jonas´ Buch Das Prinzip der Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologisierte Zivilisation beziehen: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ Bei den gesellschaftlichen Auswirkungen der Informatik steht nicht immer gleich der Bestand der Menschheit auf dem Spiel, wohl aber der der Arbeitswelt, der Kultur, der Freiheit, der Demokratie und des Friedens.
Es folgen anhängend Informationen zum Programm der Jahrestagung und insbesondere zu den Arbeitsgruppen. Weitere Informationen und Ergänzungen können auf der Webseite der Jahrestagung nachgelesen werden.
Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Mitgliedschaft im FIfF wird nicht vorausgesetzt. Kommentare, Anregungen, Fragen und Wünsche sind willkommen
Programm
Freitag, 13. November 2009 – Haus der Wissenschaft
Öffnung des Tagungsbüros ab 18:00
19:00
Öffentlicher Auftakt zum Thema Netz_aktiv
mit zwei Vorträgen und moderiertem Forumsgespräch mit dem Publikum
- Hendrik Speck (Fachhochschule Kaiserslautern): sozial.total.vernetzt
- Lars Reppesgaard (freier Journalist, Hamburg):google.macht.wissen
- Moderator: Stefan Pulß (Radio Bremen)
Samstag, 14. November 2009 -- Universität Bremen
Öffnung des Tagungsbüros ab 09:00
09:30
Begrüßung, Vorträge (30 min Pause gegen 11:00)
- Constanze Kurz (CCC und Humboldt Universität zu Berlin):Gewissensbisse oder Zivilcourage? -- Ethik und Informatik in der Lehre
- Eliane Fernandes Ferreira (Universität Bremen): Der "Digitale Bogen" -- Die Indigenen Brasiliens und das Internet
12:30
Mittagessen
14:00
Arbeitsgruppen
16:30
Pause
17:00
Vortrag
Hans-Jörg Kreowski (FIfF und Universität Bremen) ...vorher -- 25 Jahre Informatik und FIfF -- nachher...
18:30
Abendprogramm
(bis voraussichtlich 23:00 Uhr)
Sonntag, 15. November 2009 -- Villa Ichon
09:00
Frühstücksbuffet
10:00
Mitgliederversammlung des FIfF
(bis voraussichtlich 13:00 Uhr)
Arbeitsgruppen
AG 1
Spiele ohne Grenzen?
Organisation: Ulrike Erb, Susanne Maass, Heidi Schelhowe, Karin Vosseberg, Margita Zallmann
Dieser Workshop beschäftigt sich mit den Erlebniswelten junger Menschen in gängigen Computer(rollen)spielen wie "World of Warcraft", "Sims" u.a. Zunächst sollen verschiedene beliebte Computerspiele von vier Jugendlichen vorgeführt werden. Die Workshop-TeilnehmerInnen können dabei den SpielerInnen über die Schulter gucken. Anschließend wollen wir mit den Jugendlichen über ihre Erfahrungen beim Spielen ins Gespräch kommen: Welche Faszination wird durch die Spiele ausgelöst? Wie wird Gewalt erlebt? Wie wird der Zusammenhang zwischen virtueller und realer Welt gesehen? Welche Erfahrungen gibt es beim Spielen in unterschiedlichen Geschlechterrollen? ... Diese und ähnliche Fragen sollen diskutiert werden. In einer zweiten Phase wollen wir gesellschaftliche Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten (auch aus Sicht der Informatik) diskutieren
AG 2: Computer aus dem Sweatshop
Computer aus dem Sweatshop:
Was Dein Notebook mit Menschenwürde zu tun hat
... und wie Du zu einer Besserung beitragen kannst.
In der Arbeitsgruppe geht es vor allem, aber nicht nur, um die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung der vielen Elektronik, die zu immer niedrigeren Preisen in die Märkte der Welt gedrückt wird.
Made in the Peoples Republic of China, Taiwan oder Hong Kong, das lesen wir klein gedruckt auf den Typenschildchen unseres neuesten elektronischen Spielzeugs. Die Region ist davon abhängig, wo gerade die jeweils billigste verlängerte Werkbank der großen Konzerne gerade steht. Wir denken nur selten darüber nach, was diese Werkbank so attraktiv für die Hersteller macht:
-
Ein Arbeitsrecht, das kaum durchgesetzt wird und das selbst dann für die Käufer der Geräte völlig indiskutabel wäre,
-
Umweltauflagen, die niemand kontrolliert und die uns die Haare zu Berge stehen lassen würden,
-
und politische und wirtschaftliche Verhältnisse, die keine Veränderung zulassen.
Vielleicht sind die Verhältnisse so, weil wir uns zu wenig dafür interessieren, zu wenig darüber wissen und keine Vorstellung haben, wie sie zu ändern wären. Dabei sind wir Verbraucher in den Industriestaaten bei der Kaufentscheidung nicht ohnmächtig. Nichtregierungsorganisationen aus mehreren Ländern klären auf und geben Anregungen, was zu tun ist. In Deutschland sind es WEED und Germanwatch. Ein Beitrag in dieser FIfF-Kommunikation soll einen ersten Überblick geben, und auf der Jahrestagung wollen wir uns ausführlicher mit dem Thema beschäftigen.Es wird um Herstellung, Beschaffung, Betrieb und Entsorgung der Geräte gehen, mit vielen interessanten Informationen. Was uns besonders wichtig ist: Es gibt Handlungsmöglichkeiten, und vielleicht können auch die Teilnehmer/-innen der AG neue Anregungen beisteuern.
Organisation: Dagmar Boedicker und Sebastian Jekutsch
AG 3
Informatik und Gesellschaft –
Resurrection of the Dead oder Flug des Phönix?
Organisation: Karl-Heinz Rödiger und Karsten Weber
Nachdem aufgrund einer bestimmten politischen Grundstimmung in den 1970er und 1980er Jahren das Themenfeld der Informatik und Gesellschaft (IuG) zumindest fachintern Aufmerksamkeit fand und die Diskussionen um das Verhältnis von Informatik als Fachwissenschaft und Ort der Entwicklung informationstechnischer Artefakte auf der einen Seite und Gesellschaft als Ort, an dem die Wirkungen jener Artefakte greifen, auf der anderen Seite wertvolle Erträge zeitigten, ist es derzeit eher still geworden um Informatik und Gesellschaft. Zwar hat sich die Gesellschaft für Informatik 1994 Ethische Leitlinien gegeben, die zu Beginn des neuen Jahrtausends überarbeitet wurden, doch ansonsten gelingt es kaum noch, breite Öffentlichkeiten für IuG-Themen zu interessieren – dies lässt sich paradigmatisch am Thema der Online-Durchsuchung und anderen Fragen im Umfeld von Privatsphäre und Datenschutz erkennen: War es 1987 beinahe Volkssport, durch alle politischen und sozialen Schichten hinweg, die Volkszählung zu unterlaufen, reduziert sich heute der Protest gegen Einschränkungen der Privatsphäre und des Datenschutzes in erster Linie auf Äußerungen in den Medien. Auch die fachwissenschaftliche Debatte hierzu ist, zumindest oberflächlich, fast zum Stillstand gekommen.
Dabei zeigen gerade Themen wie die Online-Durchsuchung, dass die Fragen aus dem Themenfeld Informatik und Gesellschaft nach wie vor hoch aktuell sind. Doch können berechtigte Zweifel daran erhoben werden, ob sie mit den Konzepten beantwortet werden können, die in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt wurden. Viele der angebotenen Lösungen setzen, wenn auch eher implizit als explizit, auf einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel und den Umbau der Wirtschaftsweise, doch konkrete und praktikable Lösungen für konkrete Probleme wurden eher selten entwickelt, wenn es um die zentralen Fragen von IuG ging.
Dieses Defizit konnte natürlich nicht ohne Wirkung bleiben: Inzwischen ist IuG innerhalb der Informatik institutionell nur noch sehr schwach verankert, andere Disziplinen behandeln das Thema ebenfalls eher randständig, vor allem aber in aller Regel sehr praxisfern. Daher ist die Frage zu stellen, wie IuG innerhalb der Informatik in Zukunft thematisiert werden sollte: Der Rückgriff, so die provokante These des Workshop-Titels, auf die Konzepte aus den Anfangszeiten von IuG bedeutet die Wiedererweckung der Toten – und führt möglicherweise zu ähnlich absurden Ergebnissen, wie in Ed Woods skurrilem B-Movie Plan 9 from Outer Space. Eine weitere Alternative wird durch den Filmtitel Der Flug des Phönix angedeutet: Nutzung funktionierender Ideen und Konzepte aus IuG, Neukombination und Anpassung an bestehende Verhältnisse. Die dritte Alternative taucht nicht mehr im Titel des Workshops auf: Die Entwicklung ganz neuer Konzepte oder doch zumindest die Adaption von Ideen aus anderen Disziplinen als der normativ orientierten Philosophie und Soziologie.
Der Workshop soll dazu dienen, diese drei Alternativen auszuloten, ihre Gangbarkeit zu evaluieren und Vorschläge zu entwickeln, wie IuG in Zukunft aussehen könnte. Hierbei sind sowohl theoretisch gelagerte als auch empirisch gestützte Beiträge erwünscht, wobei aber immer die Weiterentwicklung des Themenfeldes und nicht Detailfragen im Vordergrund stehen sollen.
AG 4
Commons und Peer-Produktion
Organisation:Christian Siefkes
In den letzten Jahrzehnten ist eine neue Produktionsweise entstanden, die auf Kooperation und Teilen beruht. Auf dieser Produktionsweise -- Peer-Produktion genannt -- basieren Freie Software (wie Linux und Firefox), die Wikipedia und die Freie-Kultur-Bewegung; sie steckt hinter Freien Funknetzen und Projekten wie SETI@home. Peer-Produktion nutzt und erzeugt Commons (Gemeingüter): Ressourcen und Güter, die allen zustehen und gemäß selbstdefinierten Regeln gemeinsam oder anteilig genutzt werden. Sie basiert auf Beiträgen statt auf Tausch: Menschen beteiligen sich an Projekten, die ihnen wichtig sind, und tragen so zu deren Erfolg bei. Und sie basiert auf freiwilliger, zwangloser Kooperation, die keine formalen Hierarchien und Befehlsstrukturen kennt.
In dem Workshop soll es darum gehen, was Commons sind und wie Peer-Produktion funktioniert. Vor allem aber geht es um die Frage, wie die Peer-Produktion den Sprung von der immateriellen in die materielle Welt schaffen kann: wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die im Wesentlichen auf Peer-Produktion beruht, so dass es kein Geld und keinen Markt mehr braucht?
Organisiert von
Publikationen dazu
Beiträge dazu
Verwandte Themen

Arbeit
Die Auswirkung von Informationstechnik auf Arbeit ist einer der Themenschwerpunkte des FIfF, der mit weiteren FIfF-Themen und -Forderungen in enger Verbindung steht. Die Auswirkung von Informationstechnik auf Arbeit ist einer der Themenschwerpunkte des FIfF, der mit weiteren FIfF-Themen und -Forderungen in enger Verbindung steht.